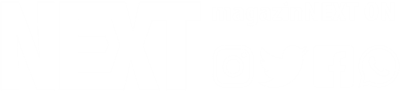Zum zweiunddreißigsten Mal unterhält sich Dieter Aurass bereits mit einem regionalen Schriftsteller über das Schreiben und Veröffentlichen von Büchern. Der sechzigjährige, gebürtige Saarländer ist hauptberuflich Leiter der Studienberatung an der Universität Trier. Frank P. Meyer erzählt uns, was ihn mit der Stadt Trier verbindet, was er bereits veröffentlicht hat und über seine doch sehr außergewöhnliche Vorgehensweise beim Schreiben.
Hier der Link/QR Code
Frank, du warst vor zehn Jahren Stadtschreiber von Trier. Was macht ein Stadtschreiber denn so?
Ein Stadtschreiber macht, wenn er klug ist, einfach, was er will. Der Stadtschreiber hat die Aufgabe, präsent zu sein, sich der Stadt zu zeigen und das, was er gerade schreibt, in irgendeiner Weise mit der Stadt zu verbinden. Ich habe die Chance damals ergriffen, jede Woche eine Kolumne zu schreiben. Ich hatte bis dahin noch keine einzige Kolumne geschrieben und dachte, das würde gar nicht gut gehen. Aber es ging gut. Ich habe damals eine Wohnung bekommen, mitten in der Stadt, am Dom und mit Blick in das Arbeitszimmer des Bischofs. Der hat abends genauso lang gearbeitet wie ich auch. Bis heute bin ich da nicht mehr ganz von weggekommen. Gelegentlich schreibe ich immer noch Kolumnen für zwei Zeitschriften. Zwar nicht mehr so häufig – eher alle sechs bis acht Wochen – aber das ist das Geschenk, das die Stadtschreiberzeit mir gemacht hat.
Wusstest du von Anfang an, dass du Autor werden willst?
Ja, das wusste ich, das war schon zu Schulzeiten klar. Ich habe immer schon geschrieben – anfangs natürlich noch keine Romane. Der tatsächliche Einstieg kam durch das Übersetzen. Schon während meiner Studienzeit hatte ich das Glück, einige Sammelbände – auf Englisch und Niederländisch – übersetzen zu dürfen. Auch mal einen größeren Teil – und das war die beste Schule für mich. So habe ich mich auch im eigenen Schreiben weiterentwickelt. Ich habe zum Beispiel gesehen, welchen Running Gag der Autor oder die Autorin durch die ganze Erzählung hindurch verwendet hat, und musste mir überlegen, wie ich das auf Deutsch sachgemäß übersetzen kann. Durch das Übersetzen habe ich über die deutsche Sprache viel gelernt, aber auch darüber, wie man eine Erzählung am besten aufbaut. Nach etlichen Übersetzungen habe ich gemerkt: Ich kann und will das auch, ich will eigene Erzählungen veröffentlichen. Die Romane kamen dann allerdings erst später, als ich schon ein paar eigene Sammelbände herausgegeben hatte.
Wir kommen jetzt tatsächlich mal auf deinen aktuellen Roman „Vom Ende der Bundeskegelbahn“. Was ich für einen wirklich interessanten und neugierig machenden Titel halte. Um was geht es in dem Buch?
Ganz grob gesagt geht es um die Globalisierung, um einen Wandel auf dem Land. Ich habe eigentlich immer Dorf-Settings in meinen Büchern und beschreibe typische Strukturen und auch kulturelle Eigenheiten des Dorflebens. Es gab eine Art Anlass zu dem Thema des Buches: Ich habe gesehen, dass sich einige chinesische Firmen jetzt im Bereich Hunsrück, Nordsaarland niederlassen. Ich hielt das für eine tolle Idee für eine Geschichte. So habe ich mir einen Chinesen ausgedacht – Wang Fei – und ihn in ein Dorf, das übrigens mein Heimatdorf darstellt, gesetzt. Wang fängt an, das halbe Dorf aufzukaufen und man sollte deutlich sehen, wie sich die Bewohner des Dorfes aufgrund dessen verhalten: Wer hilft dem Chinesen, wer bildet eine Art Opposition, wer steht zwischen beidem? Die Kegelbahn ist deshalb wichtig, weil man erkennt, dass alles, was in dem Dorf in den 50er und 60er Jahren noch von Bedeutung war, mittlerweile verschwindet. Unter anderem betreibt der Chinese die letzte noch verbliebene Kegelbahn und wird ein riesiger Fan von deutschem Kulturgut, ist zum Beispiel begeisterter Chorsänger.
Jetzt haben wir darüber gesprochen, was du schreibst, aber noch nicht, wie du schreibst. Was für ein Typ Schreiberling bist du? Strukturiert? Weniger strukturiert? Ordentlich? Oder eher der Chaot?
Das glaubt mir fast niemand, aber bei Romanen bin ich unfassbar strukturiert. Kolumnen schreibe ich, wenn ich etwas erlebt habe und dann nach Hause komme. Romane sind bei mir eine akribische Planungsarbeit. Ich schreibe immer den Schluss zuerst, und wenn der steht, weiß ich, welche anderen Kapitel wichtig sind. Die schreibe ich und habe daraufhin so etwas wie ein Baugerüst, in dem ich am Ende die Lücken zuschreibe. Meine Frau sagt manchmal zu mir: „Lass mich mal was lesen!“ Und ich antworte ihr: „Das bringt nichts. Du weißt überhaupt nicht, wie diese fünf Kapitel zusammenhängen, die sind viel zu weit auseinander.“ Jetzt, bei der Bundeskegelbahn habe ich es anders gemacht, weil alle sich über meinen Arbeitsstil gewundert haben. Ich habe einfach drauf los geschrieben. Am Anfang war es ein rauschhaftes Drauflosschreiben, bis ins letzte Drittel. Dann plötzlich stimmte was in dem und dem Kapitel nicht mehr und ich musste echt viel herumbasteln. Es war eine klasse Erfahrung – die ich aber nie wieder machen möchte. Ich lasse mich auch nicht von meinen Figuren und der Handlung überraschen. Alles steht schon so fest, wie es passieren soll.
Du bist mit dem Schreiben großgeworden. Gibt es etwas, das du Leuten raten würdest, die mit dem Schreiben beginnen wollen?
Wirklich erstmal schreiben, schreiben, schreiben. Das ist ähnlich wie im Sport oder in der Musik: Man muss viel üben. Wenn man nun darüber nachdenkt, etwas zu veröffentlichen, ist es wichtig, das Geschriebene in einem angstfreien Kreis vortragen zu können. Also heißt es eigentlich immer: Schreiben, schreiben, schreiben und zeigen, zeigen, zeigen! Vielleicht nicht nur der wohlmeinenden Oma oder dem Freund und der Freundin, sondern dann auch Leuten, die selbst schreiben. Und wenn die fair sind, ist das die beste Quelle, um aus dem zu lernen, was man geschrieben hat.
Mehr aus dem Gespräch zwischen Dieter Aurass und Frank P.Meyer könnt ihr euch online auf Anchor, Spotify etc oder auf unseren sozialen Kanälen anhören.